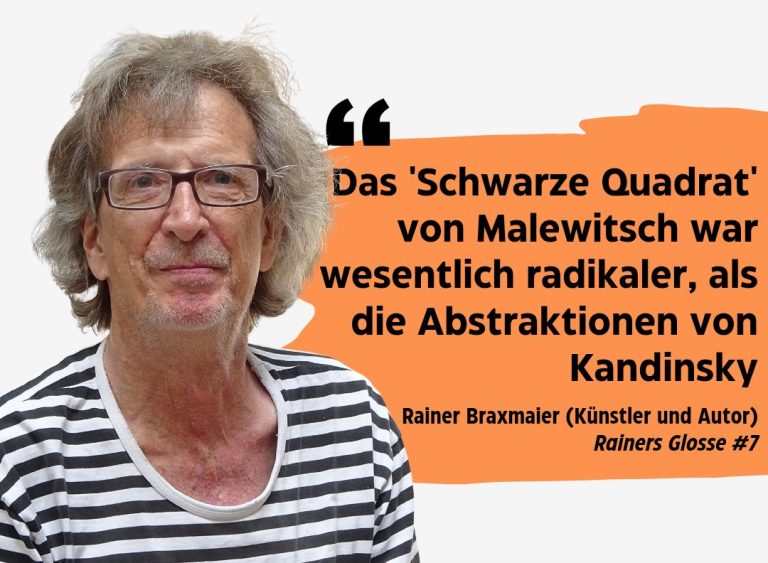
Die Vorurteile, die sich gegen Kunst richtet, die nicht die sichtbare Umgebung abbildet, sind altbekannt und haben sich wenig verändert: „abstrakte Schmierereien“, in denen der Zufall Regie führt und die keiner handwerklichen Fähigkeiten bedürfen. „Das kann unsere Dreijährige ja auch“, hört man oder den berühmten Versuch, einen Affen ein Bild malen zu lassen.
Unbehagen am Ungewohnten
Woher kommen diese in ihrer Überspitzung unflätigen Vorurteile? Ein Hauptmotiv ist bestimmt die Unsicherheit angesichts einer fremden Welt, deren Gesetzmäßigkeiten man nicht begreift. Ein Unbehagen am Ungewohnten. Dabei geht es nicht darum, alles schön zu finden, was an den Wänden hängt. Doch wer etwas tiefer in die Materie eindringt, kann sich leichter eine Meinung bilden.
Vorreiter Wassily Kandinsky
Zunächst: die Frage: „Was ist abstrakt?“ – und damit das Problem mit dem sichtbaren Unsichtbaren, das älter ist, als die meisten glauben. Als erstes gegenstandsfreies Bild gilt ein Werk von Wassily Kandinsky aus dem Jahr 1911, „Komposition V“. Das berühmte „Schwarze Quadrat“ des russischen Malers Kasimir Malewitsch, das überhaupt keine gegenständliche Assoziation mehr zuließ, stammt aus dem Jahr 1915 – und wie es damals in St. Petersburg ausgestellt war, ist bezeichnend. Es hing hoch über allen anderen Bildern der Ausstellung, leicht nach vorne gekippt über eine Raumecke, wie eine Kreuzigung im „Herrgottswinkel“. Man war sich also dem spirituellen Gehalt dieser malerischen Tat wohl durchaus bewusst. Das alles ist mehr als einhundert Jahre her – lohnt sich die Aufregung?
Veränderter Natureindruck
Um auf den Kern der Sache zu kommen, sollte man sich die Bedeutung des Begriffs „abstrakt“ genauer ansehen. Das Wort kommt aus dem Lateinischen und „abstrahieren“ bedeutet eigentlich „abziehen“ – im erweiterten Sinn „verdichten“ oder „verallgemeinern“. Das heißt: die abstrakte Malerei ist überhaupt nicht gegenstandsfrei, sondern verändert einen Natureindruck, geht also ursprünglich von einem Gegenstand aus.
Ohne Bezug zur Natur
Das bedeutet aber auch: das „Schwarze Quadrat“ von Malewitsch war wesentlich radikaler, als die Abstraktionen von Kandinsky, denn es verdichtete keine gegenständliche Erscheinung. Später nannte man diese Malerei „konkrete Kunst“, denn sie bedeutet nichts anderes, als das, was sie zeigt: eine Form (Quadrat) und eine Farbe (schwarz) – ohne jeden Bezug zur Natur. Der Endpunkt der Malerei ist also schon 110 Jahre alt!
Bedenkenlos ausgetobt
Dass diese Auseinandersetzung bis auf den heutigen Tag aktuell ist, beweist die neueste Ausstellung „Das Ende des Sichtbaren“ im Kunstverein Offenburg mit den beiden Ortenauer Künstlern Manfred Schlindwein und Johannes Renzenbrink. Obgleich das Zeitalter der Avantgarde längst vorbei ist, in dem der Fortschrittsgedanke das künstlerische Denken beherrschte, und man sich auf allen Feldern der Kunst bedenkenlos austoben durfte, liefern die jahrzehntelang entwickelten Werke der Beiden lupenreine Beispiele für die Kunst der Abstraktion. Johannes Renzenbrink zum Beispiel hat seine Malerei in organische Streifenstrukturen organisiert – und was verdichtet er? Natureindrücke!


Bilder von Johannes Renzenbrink (oben) und Manfred Schlindwein werden in Offenburg gezeigt. Fotos: Nicole Braxmaier
Geschulte Ästhetik
In der Horizontalen sind es Elemente von Landschaften, in der Vertikalen Baumstrukturen. Renzenbrink malt nicht ab, sondern verdichtet seine in der Natur gewonnen Eindrücke in eine Malerei, die eine geschulte Ästhetik spiegelt, nicht nur was die Formen angeht, sondern auch das Kolorit, die Auswahl der Farben.
Lebhafte Eigendynamik
Bei Manfred Schlindwein funktioniert die Abstraktion etwas wilder und vielfältiger. Er liebt den freien Fluss der Linie, ist farbig zurückhaltender, dabei scheinbar chaotisch strukturiert. Die Formen seiner Holzschnitt-Collagen sind vielfältiger,. Im Hintergrund schimmern figurale Elemente, schriftartige Eindrücke und eine lebhafte Eigendynamik der Formen hervor – die er zusammensetzt zu einem einheitlichen ästhetischen Gesamteindruck.
Abseits von allen theoretischen Unterweisungen hat die Präsentation viele genießende Betrachter verdient. Bis zum 20. Dezember im Kunstverein Offenburg-Mittelbaden e.V., Amand-Goegg-Str. 2, 77654 Offenburg, geöffnet Mittwoch – Freitags 14 – 18 Uhr, Samstags und Sonntags 11 – 17 Uhr. Internet: https://kunstverein-offenburg.de/
Siehe auch hier:
Rainers Glosse #5: Die Kunst des Reisens – Reisen zur Kunst – 6 inspirierende Sommertipps